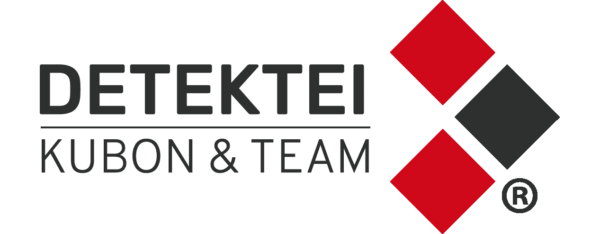BAG Beweiswert von Krankschreibungen
Die Richter sahen in diesem Fall den Beweiswert der AU als erschüttert an.
Bundesarbeitsgericht
Aktenzeichen 5 AZR 149/21

Erschütterter Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach Kündigung
Normalerweise hat eine vom Arzt bescheinigte Arbeitsunfähigkeit einen Beweiswert zugunsten des Arbeitnehmers. Sie löst den Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitgebers aus. Hat der Arbeitgeber berechtigte Zweifel am tatsächlichen Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit, muss er diese Zweifel konkretisieren.
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem aktuellen Urteil die Beweislast umgekehrt. In dem aktuellen Fall meldete sich eine Arbeitnehmerin nach Eigenkündigung mit ärztlicher Bescheinigung arbeitsunfähig für einen Zeitraum krank, der exakt die Kündigungsfrist umfasste. Die Richter sahen in diesem Fall den Beweiswert der AU als erschüttert an. Welche Folgen hat dieses Urteil für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber?
Das Urteil und seine Begründung
Im Urteil vom 8. September 2021 zum Aktenzeichen 5 AZR 149/21 sahen die Bundesarbeitsrichter im Gegensatz zu den vorhergehenden Instanzen den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeit als erschüttert an. Sie nahmen die Arbeitnehmerin in die Pflicht, die Arbeitsunfähigkeit zu beweisen. Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Arbeitnehmerin hat ihr Arbeitsverhältnis selbst gekündigt. Am 8. Februar eines Jahres reichte sie die Eigenkündigung beim Arbeitgeber ein. Die Kündigungsfrist erstreckte sich bis zum 22. Februar. Passgenau zum 8. Februar legte sie ihrem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor, die ebenso passgenau den Zeitraum der Kündigungsfrist bis zum 22. des Monats abdeckte. Außerdem hatte die Arbeitnehmerin gegenüber einem Kollegen schon vorher erklärt, dass sie nicht mehr zur Arbeit kommen werde.
Dabei war von einer Arbeitsunfähigkeit nicht die Rede. Der Arbeitgeber verweigerte daraufhin die Entgeltfortzahlung für den Zeitraum der Erkrankung. Die Arbeitnehmerin hatte ihre Arbeitsunfähigkeit mit einem drohenden Burn-out begründet, dafür aber keinen weiteren Beweis angetreten. In den beiden ersten Instanzen urteilten die Richter zugunsten der Arbeitnehmerin. Sie sahen den Entgeltfortzahlungsanspruch als gegeben an.
Das Bundesarbeitsgericht beurteilte die Sachlage anders. Die Richter nahmen an, dass der Beweiswert der AU allein durch die exakte Passung auf die Kündigungsfrist erschüttert sei. Damit gingen sie von einer Umkehrung der Beweislast aus. Aus ihrer Sicht konnte die Arbeitnehmerin im Prozess nicht beweisen, dass sie tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt war. Ein Lohnfortzahlungsanspruch für den Zeitraum der Erkrankung war damit nicht gegeben.
Der rechtliche Hintergrund des Urteils
Die Frage der Beweislast ist im Arbeitsrecht essenziell. Dieses aktuelle Urteil des BAG hat große Bedeutung für die allgemeine Bewertung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Bisher haben Arbeitsrichter nur in seltenen Fällen angenommen, dass der Beweiswert einer AU erschüttert worden sei.
In der Regel musste dabei der Arbeitgeber seinerseits Tatsachen und Indizien darlegen, die seine berechtigten Zweifel an der tatsächlichen Erkrankung untermauern konnten. In diesem Fall war ein weiterer Vortrag des Arbeitgebers jedoch nicht notwendig. Die Richter beurteilten allein die Tatsache, dass sich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genau auf den Zeitraum der Kündigungsfrist erstreckte, als maßgeblich.
Jetzt hätte die Arbeitnehmerin substantiiert darlegen müssen, dass sie tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt war. Das hätte beispielsweise über die Befreiung des behandelnden Arztes von der Schweigepflicht, durch dessen Einlassungen erfolgen können. Die Bundesarbeitsrichter hatten die Klägerin auch auf diese Möglichkeit hingewiesen. Sie reagierte nicht auf den Hinweis und konnte deshalb den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht wiederherstellen.
Auch wenn es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt, macht das Urteil deutlich, dass Arbeitsrichter die Umkehr der Beweislast bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen grundsätzlich nicht scheuen.
Was folgt aus dem Urteil für Arbeitnehmer?
Arbeitnehmer können auch mit einer vom Arzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeit nicht automatisch mit einer Lohnfortzahlung rechnen. Ergeben sich ernsthafte Zweifel am Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit, kann der Beweiswert der AU erschüttert sein. Das führt zu einer Beweislastumkehr. Der Arbeitnehmer muss dann nachweisen, dass er tatsächlich arbeitsunfähig krank war. Möglich ist dies beispielsweise durch Vernehmung des behandelnden Arztes nach Freistellung von der ärztlichen Schweigepflicht.
Prinzipiell nehmen sich Richter hier einem Phänomen an, dass in der arbeitsrechtlichen Praxis häufig auftritt. Ein Arbeitnehmer kündigt oder wird gekündigt, danach meldet er sich krank. In Zukunft werden es Arbeitnehmer schwerer haben, während der Kündigungsfrist nach Krankschreibung weiter Entgelt vom Arbeitgeber zu beziehen.
Es kommt stärker auf die Würdigung jedes einzelnen Falles und seiner Umstände an. Die Krankschreibungen mit Entgeltfortzahlung nach Kündigung könnten zukünftig kein typischer Selbstläufer sein.
Arbeitnehmer müssen sich verstärkt darauf einrichten, dass ihre Arbeitsunfähigkeit im zeitlichen Zusammenhang mit einer Kündigung stärker hinterfragt wird. Nicht immer werden dabei die Zweifel so eindeutig ablesbar sein wie in diesem Fall.
Aber insgesamt könnten Arbeitgeber intensiver ihre Möglichkeiten wahrnehmen, berechtigte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit im Kontext einer Kündigung durch Indizien zu konkretisieren. Dabei ist es keinesfalls sicher, dass Arbeitsrichter zugunsten der Arbeitnehmer entscheiden.
Welche Bedeutung hat das Urteil für Arbeitgeber?
Das Urteil unterstreicht die Möglichkeiten des Arbeitgebers, berechtigte Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit geltend zu machen und die Lohnentgeltfortzahlung zu verweigern. Zwar war der Sachverhalt in diesem aktuellen Fall sehr deutlich, da die Arbeitsunfähigkeit exakt die Kündigungsfrist abdeckte. Jedoch kann es sich insgesamt für Arbeitgeber lohnen, beispielsweise mithilfe einer Detektei Zweifel an einer Erkrankung von Arbeitnehmern geltend zu machen.
Das Urteil zeigt, dass der Beweiswert von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu erschüttern ist. Es kann sich für Arbeitgeber lohnen, unter bestimmten Umständen Detektive auf einen Fall anzusetzen, um weitere Indizien für bestehende Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit zu recherchieren. Die Sichtweise der Arbeitsrichter untermauert, dass der Beweiswert einer AU nicht automatisch unerschütterlich ist.
Gelingt es dem Arbeitgeber, eine Beweislastumkehr herbeizuführen, wird der Lohnfortzahlungsanspruch zu Fall gebracht. Wie das Urteil auch zeigt, sind Arbeitnehmer in diesem Fall nicht immer in der Lage, den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht freizustellen und ihn im gerichtlichen Verfahren vernehmen zu lassen. Man kann davon ausgehen, dass auch Ärzte nicht immer dazu bereit sind.
Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber bei Zweifeln an einer Arbeitsunfähigkeit?
Schon nach der bisherigen Rechtsprechung ergeben sich Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeit insbesondere unter diesen Gesichtspunkten:
- Arbeitnehmer sind häufig nur für kurze Zeit arbeitsunfähig krankgeschrieben.
- Die Arbeitsunfähigkeit fällt häufig auf den Beginn oder das Ende einer Woche.
- Das Attest stammt von einem Arzt, der dafür bekannt ist, häufig AU-Bescheinigungen auszustellen.
- Die Arbeitsunfähigkeit wurde vorher angekündigt.
- Die AU tritt auffällig häufig zum Ende eines Monats ein.
- Es kommen unzulässig rückwirkende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor.
Diese Aufzählung ist nicht als abschließend zu betrachten, zeigt aber typische Beispiele auf, in denen Zweifel des Arbeitgebers berechtigt sein können. In allen diesen Fällen kann es sich lohnen, dass der Arbeitgeber mehr Informationen über die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seines Arbeitnehmers einholt. Damit kann der Beweiswert der AU-Bescheinigung unter Umständen erschüttert werden.
Der Arbeitgeber hat außerdem die Möglichkeit, den medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen einzuschalten. Er kann verlangen, dass der medizinische Dienst eine Begutachtung beauftragt. Ergibt sich aus den der Krankenkasse vorliegenden Unterlagen nicht eindeutig, dass der Arbeitnehmer medizinisch arbeitsunfähig ist, kann die jeweilige Kasse die Anfrage eines Arbeitgebers nicht ablehnen.
Fazit: „Krankfeiern“ wird zukünftig erschwert
Dieses aktuelle Bundesarbeitsgerichtsurteil sollte Arbeitgeber ermutigen, Zweifeln an einer Arbeitsunfähigkeit verstärkt nachzugehen und diese gegebenenfalls auch geltend zu machen. Das gilt nicht nur im Kontext einer Kündigung, der sich eine Arbeitsunfähigkeit zeitlich anschließt. Hier sind auch spezialisierte Detekteien gefragt, um Arbeitgeber bei der Darlegung ihres Standpunktes durch Ermittlungen zu unterstützen. In vielen Fällen wird es Arbeitnehmern künftig schwerer fallen, ihren Entgeltfortzahlungsanspruch bei AU geltend zu machen.
Speziell im Zusammenhang mit einer Kündigung dürfen und sollten Arbeitgeber genauer hinsehen, wenn ihnen passgenau eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt wird. Das Urteil hat hier dazu beigetragen, einen für den Arbeitgeber nachteiligen und unfairen Automatismus zu durchbrechen.