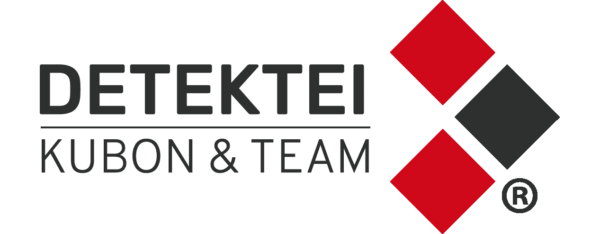Mancher Arbeitnehmer wird von einer Kündigung überrascht. Der Schock sitzt tief, sodass es im ersten Moment schwerfällt, angemessen zu reagieren. Eine Möglichkeit, sich gegen eine Kündigung zur Wehr zu setzen, ist die Kündigungsschutzklage. Wann sie das richtige Rechtsmittel ist und wann es sinnvoll, einen Kündigungsschutzprozess anzustrengen – hier sind die wichtigsten Fakten.
Der Kündigungsschutzprozess – was ist das und wann ist er sinnvoll?

Was ist ein Kündigungsschutzprozess?
Spricht ein Arbeitgeber eine Kündigung aus, hat der Arbeitnehmer zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Er kann sie klaglos akzeptieren, oder er kann die Kündigung anfechten. Welche Möglichkeit die richtige ist, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.
Anfechten kann ein Arbeitnehmer eine Kündigung mit der Kündigungsschutzklage unter der Voraussetzung, dass Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit bestehen. Im Mittelpunkt eines Kündigungsschutzprozesses steht deshalb die entscheidende Frage:
Ist die Kündigung wirksam oder nicht?
Die Besonderheit des Kündigungsschutzprozesses besteht darin, dass der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer die Beweislast auferlegt. Er muss beweisen und vor dem Arbeitsgericht glaubhaft machen, dass die Kündigung aus Gründen des Kündigungsschutzes unwirksam ist. Ziel eines Kündigungsschutzprozesses ist gerichtlich zu klären, ob die durch den Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung wirksam ist und das Arbeitsverhältnis dadurch beendet wurde.
Kündigungsschutzprozess: Wann eine Kündigung anfechtbar ist
In einem Kündigungsschutzprozess wird die Wirksamkeit einer Kündigung gerichtlich überprüft. Prüfgegenstand der Kündigungsschutzklage sind die Wirksamkeitsvoraussetzungen der Kündigung, ob ein Verstoß gegen das Kündigungsschutzgesetz vorliegt und ob der Arbeitgeber besonderen Kündigungsschutz genießt.
1. Die Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Kündigung im Arbeitsrecht
Damit eine Kündigung wirksam ist, muss sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen:
- Sie muss ordnungsgemäß erklärt worden sein und dem Arbeitnehmer in Schriftform vorliegen.
- Eine Kündigung bedarf eines Kündigungsgrundes, und
- sie muss dem Arbeitnehmer fristgemäß zugegangen sein.
Ist eine der genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Kündigung unwirksam.
2. Der allgemeine Kündigungsschutz
Arbeitnehmer genießen durch das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) allgemeinen Kündigungsschutz, wenn sie in demselben Unternehmen länger als sechs Monate ohne Unterbrechung beschäftigt waren und wenn es sich um einen Betrieb mit mindestens elf Arbeitnehmern handelt. Kein allgemeiner Kündigungsschutz besteht in sogenannten Kleinbetrieben, in denen die Zahl der Beschäftigten unter zehn Arbeitnehmern liegt.
Liegen diese Voraussetzungen vor und findet der allgemeine Kündigungsschutz Anwendung, muss sich die ordentliche Kündigung des Arbeitgebers auf einen der im KSchG genannten Gründe stützen. Die Kündigung muss deshalb durch Gründe gerechtfertigt sein,
- die in der Person des Arbeitnehmers liegen (personenbedingte Kündigung),
- die im Verhalten des Arbeitnehmers liegen (verhaltensbedingte Kündigung) oder
- die betriebsbedingt und sozial gerechtfertigt sind (betriebsbedingte Kündigung).
Um eine Kündigung gegenüber dem Arbeitnehmer aussprechen zu können, muss mindestens einer der genannten Gründe vorliegen. Eine bloße Behauptung reicht indes nicht aus. Die Überprüfung des Kündigungsgrundes ist Gegenstand der vom Arbeitnehmer erhobenen Kündigungsschutzklage.
Das KSchG bewirkt jedoch nicht, dass der Arbeitnehmer unkündbar ist. Liegen die im Kündigungsschutzgesetz normierten Voraussetzungen für eine betriebsbedingte, verhaltensbedingte oder personenbedingte Kündigung vor, kann eine ordentliche Kündigung vollzogen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung aus “wichtigem Grund”. Dafür bedarf es eines schwerwiegenden Anlasses, der das Abwarten der Kündigungsfrist im Rahmen einer ordentlichen Kündigung für den Arbeitgeber unzumutbar macht.
3. Der besondere Kündigungsschutz
Einzelne Personengruppen haben eine besondere Schutzbedürftigkeit, für die der Gesetzgeber den besonderen Kündigungsschutz geschaffen hat. Er ist viel weitreichender als der allgemeine Kündigungsschutz, sodass eine Kündigung nur unter sehr engen Voraussetzungen durchsetzbar und nur aus wichtigem Grund möglich ist. Oftmals bedarf eine Kündigung der Zustimmung der zuständigen Behörde.
Besonders schutzbedürftig sind Personen, die aufgrund ihrer konkreten Lebenssituation besonderen Kündigungsschutz genießen, unter anderem Schwerbehinderte, Mütter, Schwangere sowie Arbeitnehmer, die sich in einer Pflege- oder Familienpflegezeit oder in Elternzeit befinden. Dazu gehören aber auch Personengruppen mit besonderen Aufgaben oder Funktionen im Betrieb, zum Beispiel Datenschutzbeauftragte oder Betriebsräte. Kommt es dennoch zu einer Kündigung im Rahmen eines Vergleichs, erhalten besonders geschützte Personen oftmals eine deutlich höhere Abfindung.
Kündigungsschutzprozess: Wie lange hat der Arbeitnehmer Zeit für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage?
Bis wann eine die Klage für einen Kündigungsschutzprozess beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden muss, darüber trifft der Gesetzgeber in § 4 KSchG eine klare Aussage. Danach muss der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen Klage erheben, nachdem ihm die Kündigung zugegangen ist.
Wird diese Frist nicht eingehalten und der Kündigungsschutzprozess zu einem späteren Zeitpunkt angestrengt, ist die Kündigung wirksam. Ausnahmsweise ist eine nachträgliche Zulassung der Klage möglich, wenn es dem Arbeitnehmer trotz aller zumutbaren Sorgfalt nicht möglich ist, die Kündigungsschutzklage rechtzeitig zu erheben. Allerdings ist die nachträgliche Zulassung zu einem Kündigungsschutzprozess an sehr strenge Voraussetzungen gebunden.
Der Arbeitnehmer muss nachweisen, dass er an einer rechtzeitigen Einreichung der Klage gehindert wurde, zum Beispiel durch eine schwere Erkrankung. Der Antrag auf eine nachlässige Zulassung der Klage muss innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hindernisses mit entsprechenden Nachweisen gestellt werden.
Wann ein Anspruch auf eine Abfindung besteht
Bei einer Abfindung handelt es sich um eine einmalige außerordentliche Zahlung. Sie kann von einem Arbeitgeber als Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes und des damit einhergehenden Einkommensverlustes gezahlt werden. Diese Möglichkeit besteht nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die keine Arbeitnehmer sind, zum Beispiel für einen Fremdgeschäftsführer einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Zahlung einer Abfindung durch den Arbeitgeber nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gibt es jedoch nicht. Insoweit ist die weit verbreitete Annahme falsch, dass eine Kündigung untrennbar mit der Zahlung einer Abfindung verbunden ist und einem Arbeitnehmer “zusteht”.
Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen, in denen der Arbeitnehmer ausnahmsweise einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung hat. Solche anspruchsbegründenden Abfindungsregelungen können in Tarifverträgen, Sozialplänen, Einzelarbeitsverträgen und in Geschäftsführerverträgen vereinbart werden. Auch eine freiwillig getroffene vertragliche Vereinbarung über die Zahlung ist zum Beispiel in einem Aufhebungsvertrag, in einem Abwicklungsvertrag oder im Zusammenhang mit einer betriebsbedingten Kündigung möglich.
Für den Kündigungsschutzprozess bedeutet das, dass eine Kündigungsschutzklage einem gekündigten Arbeitnehmer keinen Anspruch auf die Zahlung einer Abfindung verschafft. Ist der Arbeitnehmer mit seiner Klage erfolgreich und wird die Unwirksamkeit der Kündigung im Kündigungsschutzprozess gerichtlich festgestellt, ist der Arbeitsplatz gerettet. In den meisten Fällen kehrt der Arbeitnehmer jedoch nicht an seinen Arbeitsplatz zurück, sodass stellvertretend die Zahlung einer Abfindung ausgehandelt wird.